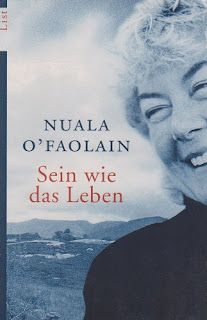Geschrieben von Sabine Neuhauß
Marianne Mewis wurde am 6.Dezember 1866 – so die Mehrzahl der Quellen – oder am 6. Dezember 1856 – so auch einige Quellen – in Arnsfelde / Westpreußen geboren. Heute heißt der Ort Gostomia und ist ein Dorf im Powiat Wałecki (Deutsch Kroner Kreis) der polnischen Woiwodschaft Westpommern.
Der Vater Albert Mewis war Gutsbesitzer, die Mutter Anna Mewis, geborene Wittich, starb früh. Diese Namen der Eltern werden im Magazin "Der Westpreuße" genannt, mit dem Hinweis, dass es sich nicht um wirklich gesicherte Erkenntnisse handelt. Naheliegend erscheint es schon, da Marianne Mewis später auch unter dem Pseudonym M. Wittich veröffentlichte.
Marianne Mewis erhielt eine gute Schulausbildung, anschließend besuchte sie ein Lehrerinnenseminar und eine Frauengewerbe- und Handelsschule. In Berlin widmete sie sich der Malerei und der Kunstgeschichte. Zwölf Jahre lang leitete sie in Dresden eine Ausbildungsanstalt für Mädchen.
Seit etwa 1900 widmete sie sich dem Schreiben, seit 1901 sind verlegte Werke nachweisbar. Sie reiste viel, vermutlich bis nach Italien und Lothringen.
Marianne Mewis verfasste Novellen, kleinere Geschichten und Romane. Damit war sie durchaus erfolgreich, einige Romane erschienen bis in die 1930er Jahre hinein in mehreren Auflagen. In den 1910er Jahren fand sie Erwähnung in Literaturlexika und -sammlungen. Jedoch war das seit den 1920er Jahren nicht mehr der Fall.
Ihre Werke werden als „Trivialliteratur“ eingeordnet. Der Roman „Der große Pan“ gilt als Musterbeispiel eines sog. „Ostmarkenromans“. Dabei handelt es sich um belletristische Literatur über die preußische Provinz Posen im 19. und frühen 20. Jahrhundert, die oftmals sehr nationalistisch gefärbt war, die Konflikte zwischen der deutschen und der polnischen Bevölkerung thematisierte und ein Bild vom deutschen Kulturauftrag im Osten zeichnete.
Seit 1928 wurde sie von der Deutschen Schillerstiftung finanziell unterstützt, sie dürfte sich also in
finanzieller Notlage befunden haben. Am 29. Dezember 1938 ist sie in Schwerin verstorben.
Werke
Vineta (unter dem Pseudonym M. Wittich) 1901
Der Sonntagsmann, 1903
Die Einfältigen, 1904
Die Grenzwarte, 1905
Der große Pan, 1908
Mettes Kinder, 1909
Peter Bröms, 1910
Der Siebenfresser und andere Geschichten, 1912
Pastings Duve, 1912
Die holde Gärtnersfrau und andere Erzählungen, 1915
Die Wolfsjägerin, 1915
Blaubart, 1917
Heisse Zeit – Reifezeit, 1919
Der Umweg zum Glück, 1920
Ärmste Prinzessin, 1921
Das Buch, 1923
Das eine Haus auf Pappelwerder, 1924
Sowohl die Vollständigkeit der Liste als auch die Erscheinungsdaten sind aufgrund der spärlichen Datenlage mit Unsicherheit behaftet!
Fazit
Ob Marianne Mewis „Trivialliteratur“ verfasst hat, möge die Leserin / der Leser für sich selbst entscheiden. Das wird allerdings kein einfaches Unterfangen, denn die Bücher sind nur antiquarisch zu erhalten, seit den 1930er Jahren gibt es keine Neuauflagen mehr. Entsprechend selten sind die Werke anzutreffen. Die wenigen Fundstellen zeigen uns, dass wir es hier wahrhaft mit einer vergessenen Autorin zu tun haben, über die wenig in Erfahrung zu bringen ist. Jedoch lässt ihr eigenständiges Leben, die Berufstätigkeit und die Entscheidung, sich auf die schriftstellerische Tätigkeit zu konzentrieren, eine interessante Persönlichkeit erahnen.
Quellen
DNB Deutsche Nationalbibliothek
Kürschners Deutscher Literatur-Kalender. 1910. Sp. 1084; mit Foto und Unterschrift